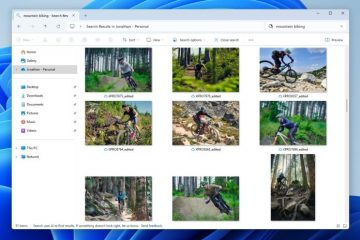Ein deutsches Gericht hat entschieden, dass ChatGPT von OpenAI urheberrechtlich geschützte Songtexte nicht reproduzieren darf. Dies ist eine bahnbrechende Entscheidung, die die Art und Weise in Frage stellt, wie generative KI-Modelle trainiert werden.
In einem heute in München verkündeten Urteil stellte sich das Landgericht München I auf die Seite der deutschen Musikrechtsorganisation GEMA und befand OpenAI für Urheberrechtsverletzungen haftbar. Seine Feststellung ergab, dass die Modelle von OpenAI illegal geschützte Werke „auswendig lernen“ und ausgeben, und wies die Verteidigung des Unternehmens zurück, dass sein Prozess durch gesetzliche Ausnahmen für Text-und Data-Mining abgedeckt sei.
Einrichtung eines bedeutenden europäischen Unternehmens Als Präzedenzfall legt das Urteil neue Verantwortlichkeiten für KI-Entwickler in Bezug auf geistiges Eigentum fest. Als Reaktion darauf hat OpenAI angekündigt, gegen die Entscheidung Berufung einzulegen.
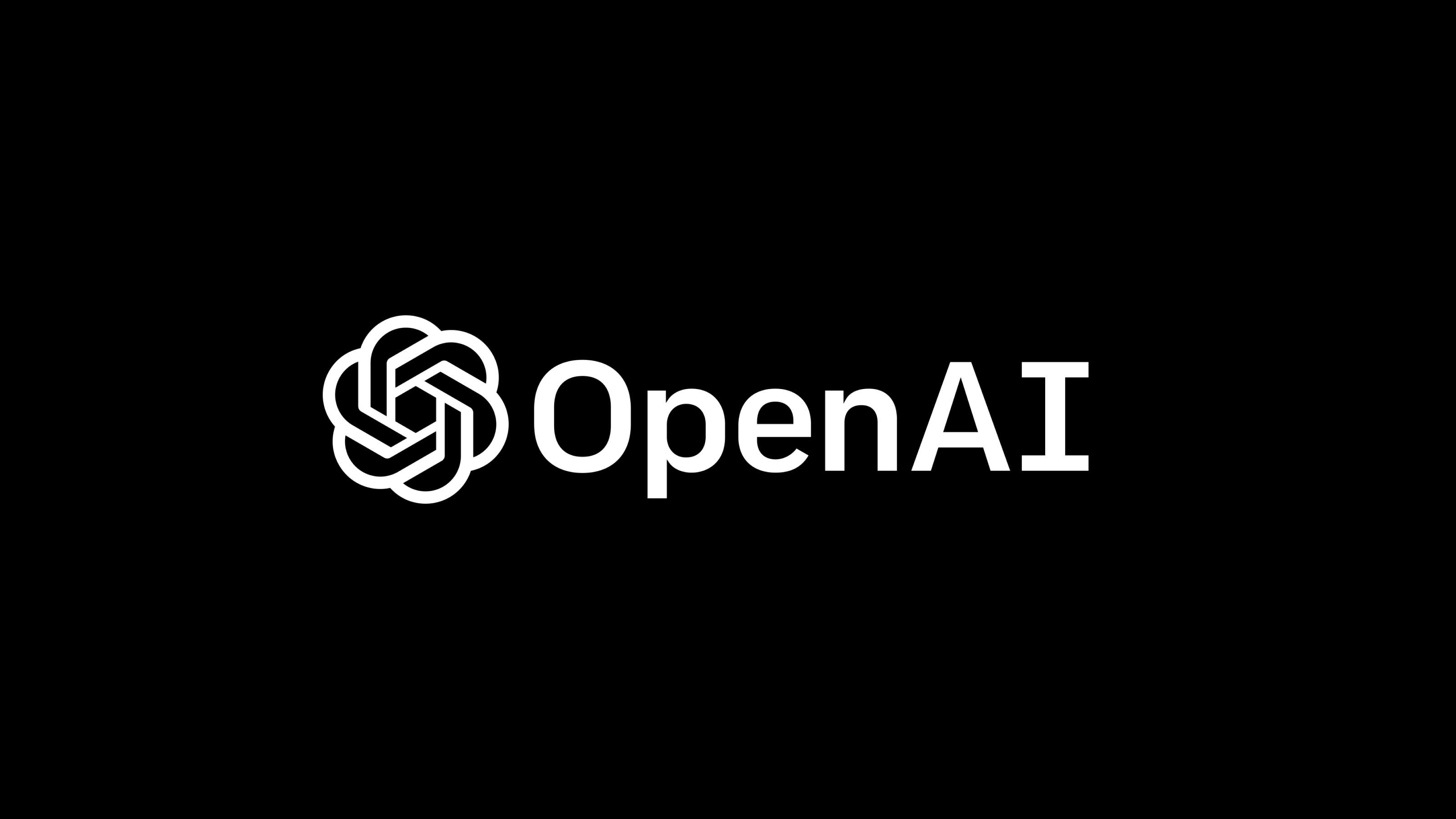
Ein wegweisendes Urteil: Gericht stuft KI-„Auswendiglernen“ als Urheberrechtsverletzung ein
In einer Entscheidung mit Auswirkungen auf die generative KI-Branche stellte das Münchner Gericht fest, dass OpenAI direkt ist verantwortlich für Urheberrechtsverletzungen, wenn sein Chatbot geschützte Liedtexte ausgibt.
Der von der GEMA im Namen mehrerer deutscher Künstler eingereichte Fall konzentrierte sich auf neun bestimmte Lieder, darunter Werke von Helene Fischer und Rolf Zuckowski.
GEMA, kurz für Gesellschaft für musikalische Aufführungs-und mechanische Vervielfältigungsrechte, ist eine deutsche Verwertungsgesellschaft, die Musikrechte im Namen von Komponisten, Textern und Musik verwaltet Verlage.
Die GEMA argumentierte, dass die Fähigkeit von ChatGPT, nahezu perfekte Reproduktionen dieser Liedtexte zu erstellen, beweise, dass sie illegal in ihren Trainingsdaten verwendet worden seien.
Im Mittelpunkt des Rechtsstreits stand die Interpretation des Begriffs „Auswendiglernen“ durch das Gericht.
Laut der offiziellen Pressemitteilung kam das Gericht zu dem Schluss, dass die Texte reproduzierbar innerhalb der Parameter des Modells enthalten waren, was eine Form der Vervielfältigung im Sinne des Urheberrechts darstellt. Eine solche Feststellung widerspricht direkt den Behauptungen einiger KI-Entwickler, dass ihre Modelle Konzepte lernen, anstatt wörtliche Kopien zu speichern.
Entscheidend war, dass das Gericht die primäre Verteidigung von OpenAI zurückwies: dass seine Aktivitäten gemäß Deutschlands Text-und Data-Mining-Ausnahme (TDM) erlaubt waren. Mit der Begründung, dieser Rechtsschutz diene der Analyse von Informationen, stellte das Gericht fest, dass er nicht anwendbar sei, wenn eine KI ganze Werke in einer Weise reproduziere, die die Gewinnmöglichkeiten des ursprünglichen Urhebers beeinträchtige.
„Die Prämisse des Text-und Data-Minings, dass keine kommerziellen Interessen beeinträchtigt werden, gilt in dieser Konstellation nicht“, erklärte das Gericht. „Im Gegenteil, die gegebenen Reproduktionen im Modell beeinträchtigen das Verwertungsrecht des Rechteinhabers.“
Das Gericht führte aus, dass die TDM-Ausnahme auf der Idee beruht, dass eine spätere Analyse die normale Verwertung des Originalwerks nicht beeinträchtigt.
Durch das Auswendiglernen und Reproduzieren von Liedtexten kam das Gericht zu dem Schluss, dass OpenAI ein Ersatzprodukt schafft, das direkt mit lizenzierten Textdiensten konkurriert und dadurch den Primärmarkt der Rechteinhaber schädigt.
Dies Eine detaillierte Auslegung schränkt die Anwendbarkeit von TDM-Schutzmaßnahmen für generative KI in Deutschland erheblich ein.
Die Richter machten außerdem OpenAI und nicht den Endnutzer für den Verstoß verantwortlich. Da die Ausgaben mit einfachen Eingabeaufforderungen generiert werden konnten, stellte das Gericht fest, dass die Systemarchitektur von OpenAI der entscheidende Faktor für den Verstoß war.
Eine divergierende Rechtslandschaft: Wie das deutsche Urteil im globalen Vergleich abschneidet
Während OpenAI seine Berufung vorbereitet, trägt das Urteil zu einem wachsenden Flickenteppich internationaler Rechtsentscheidungen bei, die keinen klaren Konsens zu KI und Urheberrecht bieten. Verschiedene Gerichtsbarkeiten kommen zu völlig unterschiedlichen Schlussfolgerungen und schaffen ein komplexes und unsicheres Umfeld für weltweit agierende Entwickler.
In den Vereinigten Staaten wurde ein ähnlicher Fall zwischen dem KI-Labor Anthropic und Musikverlegern durch einen Vergleich gelöst.
Statt eines Gerichtsurteils erklärte sich Anthropic bereit, technische „Schutzmaßnahmen“ aufrechtzuerhalten und durchzusetzen, um zu verhindern, dass seine Claude AI urheberrechtlich geschützte Liedtexte reproduziert.
Die „faire Verwendung“ des US-Rechtssystems Die Doktrin, die die unlizenzierte Nutzung von urheberrechtlich geschütztem Material für „transformative“ Zwecke erlaubt, war in vielen dieser Fälle ein zentraler Bestandteil der Verteidigung, obwohl ihre Anwendung auf das KI-Training eine heftig diskutierte und ungelöste Frage bleibt.
Es ist auch wichtig, den Musikfall von einer separaten Sammelklage zu unterscheiden, in der Anthropic eine Klage einreichte Ein Vergleichsfonds in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar für Autoren, die behaupteten, ihre Bücher seien ohne Erlaubnis für Schulungen verwendet worden.
Unterdessen bot eine aktuelle Entscheidung des Obersten Gerichtshofs des Vereinigten Königreichs in einem Fall zwischen Getty Images und Stability AI eine entwicklerfreundlichere Auslegung.
Mit der Feststellung, dass KI-generierte Ausgaben nicht auf gespeicherten oder kopierten Werken basieren, schlug das Londoner Gericht vor, dass Schulungen zu urheberrechtlich geschütztem Material nicht per se einen Verstoß nach britischem Recht darstellen. Münchens Fokus auf „Auswendiglernen“ als eine Form der Reproduktion steht in direktem Gegensatz zu diesem Befund.
Diese Divergenz verdeutlicht, wie hoch das Risiko dieser Rechtsstreitigkeiten ist. Wie die Rechtsexpertin Silke von Lewinski vom Max-Planck-Institut vor dem Urteil feststellte, ist der Ausgang solcher Verfahren für alle Urheber von entscheidender Bedeutung.
„Dies ist von grundlegender Bedeutung für alle Werke, sei es Literatur, journalistische Texte, Musik, bildende Kunst, Fotografie oder alle anderen Werke, für die verwendet wird.“ „Generative KI“, sagte sie.
Umfassendere Implikationen: Ein Präzedenzfall für alle Kreativbranchen
Obwohl sich das Münchner Urteil speziell auf Songtexte bezieht, sendet es ein starkes Signal für alle Kreativbranchen. Autoren, Journalisten, Fotografen und Softwareentwickler beobachten diese Verfahren genau, da die Rechtsgrundsätze gleichermaßen auf ihre Arbeit anwendbar sind.
Ob nicht lizenzierte Schulungen eine faire Nutzung oder einen Verstoß darstellen, bleibt der zentrale Streitpunkt.
Diese Rechtsunsicherheit erstreckt sich auch auf andere Medien, insbesondere den Journalismus. Große Verlage, darunter die New York Times, haben ähnliche Urheberrechtsklagen sowohl gegen OpenAI als auch gegen Microsoft eingereicht und argumentiert, dass generative KI-Tools ihre riesigen Artikelarchive unrechtmäßig zur Entwicklung konkurrierender Produkte nutzen.
Ein Verlust für KI-Entwickler in diesen Fällen könnte eine grundlegende Neugestaltung ihrer Geschäftsmodelle erzwingen und möglicherweise einen neuen, großen Lizenzmarkt für hochwertige Trainingsdaten schaffen.
Einige KI-Unternehmen versuchen, dem Gesetz einen Schritt voraus zu sein Herausforderungen durch den Abschluss proaktiver Lizenzvereinbarungen.
Die Sicherung einer stabilen, legalen Quelle für Trainingsdaten bei gleichzeitiger Vergütung der Urheber ist das Hauptziel dieser Strategie. OpenAI selbst hat sich mit Medienorganisationen wie TIME und Associated Press zusammengetan und einen Rahmen für die Verwendung ihrer Inhalte im Modelltraining geschaffen.
Diese Vereinbarungen schlagen einen möglichen Weg nach vorne vor und könnten dazu beitragen, umstrittene Rechtsstreitigkeiten zu umgehen.
Da jedoch unzählige Terabytes an vorhandenen Daten aus dem Internet gekratzt wurden, sind Rechtsstreitigkeiten weiterhin ein Haupttreiber der Politik.
Deutschland wird den Ausgang der Berufung von OpenAI genau beobachten, ebenso wie zahlreiche andere anhängige Klagen.
Der GEMA-Sieg in München gibt den Rechteinhabern vorerst einen erheblichen Auftrieb und argumentiert, dass KI-Unternehmen für die von ihnen verwendeten Daten zur Verantwortung gezogen werden müssen.
Es bestärkt die Idee, dass der technologische Fortschritt nicht auf Kosten etablierter Rechte an geistigem Eigentum gehen darf, und bereitet die Bühne für weitere rechtliche und regulatorische Konfrontationen.