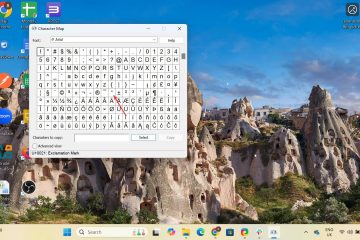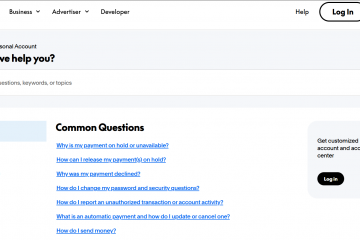Google gab am Donnerstag bekannt, dass es 200.000 Tonnen CO2-Reduktionsgutschriften von Mombak kauft, einem Unternehmen, das Ackerland im brasilianischen Amazonasgebiet wiederaufforstet.
Der Deal zielt darauf ab, den wachsenden ökologischen Fußabdruck des Technologieriesen auszugleichen, der durch den enormen Energiebedarf künstlicher Intelligenz verursacht wird. Der Kauf hat einen geschätzten Wert von 10 bis 20 Millionen US-Dollar und wurde von der Symbiosis Coalition ermöglicht, einer Klimagruppe, die von Microsoft, Meta und anderen unterstützt wird.
Der Schritt verdeutlicht eine kritische Spannung für Big Tech: die Förderung umweltfreundlicher Initiativen und die Ankurbelung eines KI-Booms, der die globalen Stromnetze belastet und Umweltkontroversen von Memphis bis Südostasien auslöst.

Ein Green Deal inmitten einer Energiekrise
Auf den ersten Blick markiert Googles Deal einen bedeutenden Schritt für den freiwilligen CO2-Markt. Der Kauf von Mombak ist das erste Projekt, das von der hochkarätigen Symbiosis Coalition ausgewählt wurde, einer Gruppe mit dem Ziel, einen Markt für hochintegrierte, naturbasierte Kohlenstoffentfernung zu fördern.
Googles Leiter für CO2-Gutschriften, Randy Spock, bezeichnete die Strategie als eine Rückkehr zu In den Grundlagen heißt es: „Die risikoärmste Technologie, die wir haben, um Kohlenstoff in der Atmosphäre zu reduzieren, ist die Photosynthese.“
Das Projekt fügt ein technologieorientiertes Element hinzu und wird Googles DeepMind AI nutzen, um dabei zu helfen, die Vorteile der Wiederaufforstungsbemühungen für die biologische Vielfalt zu quantifizieren.
[eingebetteter Inhalt]
Dennoch landet diese grüne Ankündigung mitten in einer ausgewachsenen Energiekrise, die von der KI-Industrie verursacht wurde. Angesichts des enormen Rechenbedarfs kämpfen Technologiegiganten um die Macht. Googles eigener Umweltbericht 2025 ergab, dass der Stromverbrauch seiner Rechenzentren allein im Jahr 2024 um 27 % gestiegen ist.
Diese unstillbare Nachfrage hat die Industrie für fossile Brennstoffe wiederbelebt. Wie ein ehemaliger Manager, Rich Voorberg, es unverblümt ausdrückte: „Gasturbinen waren zwischen 2022 und 2023 tot.“
Der globale KI-Rechenzentrumsboom hat nun zu einem weltweiten Mangel an Erdgasturbinen geführt, mit mehrjährigen Rückständen bei der Kernhardware neuer Kraftwerke.
KIs Zweifrontenkrieg gegen die Energie: Heute Gas, morgen saubere Energie
Der Strombedarf ist dringend Dies zwingt Unternehmen in einen Zweifrontenkrieg um Energie, in dem sofortige Maßnahmen oft im Widerspruch zu langfristigen Klimazielen stehen. In Memphis, Tennessee, hat Elon Musks xAI Dutzende temporäre Erdgasturbinen aufgestellt, um seinen Supercomputer „Colossus“ schnell online zu stellen.
Dieser Schritt hat eine überwiegend schwarze, einkommensschwache Gemeinde mit smogbildenden Stickoxiden überzogen, was heftigen lokalen Widerstand und eine Bundesklage ausgelöst hat.
Während Gasturbinen die unmittelbare Lücke füllen, nimmt auch eine ruhigere, langfristige Strategie Gestalt an. Big Tech strebt nach riesigen Mengen an „festem“ sauberem Strom, Quellen, die rund um die Uhr Strom erzeugen können. Der Pivot erkennt an, dass intermittierende erneuerbare Energien allein den konstanten Energiebedarf von KI nicht decken können.
Wie Matthew Garman, CEO von AWS, zuvor bemerkte: „Wir werden in den kommenden Jahren Gigawatt an Strom benötigen, und Wind und Sonne werden einfach nicht ausreichen.“ Zu den L
andmark-Verträgen gehört Googles 3-Milliarden-Dollar-Vertrag mit einer Laufzeit von 20 Jahren für Wasserkraft aus den Anlagen Holtwood und Safe Harbor in Pennsylvania. Meta unternahm einen ähnlichen Schritt, um seine KI mit dem wiederbelebten Kernkraftwerk Clinton in Illinois anzutreiben, und Amazon stellte 650 Millionen US-Dollar für ein Rechenzentrum zur Verfügung, das vom Kernkraftwerk Susquehanna betrieben wird.
Eine Geschichte aus zwei Hauptbüchern: Die tatsächlichen CO2-Kosten der KI
Diese Wende hin zu stärkerer Macht erfolgt inmitten einer heftigen Debatte darüber, wie Big Tech seine Umweltauswirkungen erklärt. Ein zentraler Konflikt ergibt sich aus zwei unterschiedlichen Bilanzierungsmethoden für CO2-Emissionen.
Googles Bericht stützt sich auf „marktbasierte“ Emissionen. Diese Methode ermöglicht es dem Unternehmen, seine weltweiten Einkäufe erneuerbarer Energien von seinem gesamten Fußabdruck abzuziehen, sodass es trotz steigendem Energieverbrauch eine Emissionsreduzierung von 12 % erreichen kann.
Kritiker argumentieren, dass diese Methode nicht die Realität vor Ort widerspiegelt. Die Interessenvertretung Kairos Fellowship verwendet eine „standortbasierte“ Bilanzierung, die die tatsächliche Kohlenstoffintensität der lokalen Netze misst, in denen Strom verbraucht wird.
Anhand dieser Kennzahl behauptet Kairos, dass die Emissionen von Google seit 2019 tatsächlich um 65 % gestiegen sind. Der leitende Forscher Franz Ressel behauptet: „Marktbasierte Emissionen sind eine unternehmensfreundliche Kennzahl, die die tatsächlichen Auswirkungen eines Umweltverschmutzers auf die Umwelt verschleiert.“
Für Entwicklungsländer in Südostasien sind die Konsequenzen Die Auswirkungen dieser Turbinenkrise sind besonders schlimm. Die von den USA angeführte Nachfrage hat sie faktisch vom Markt verdrängt und ihre Pläne gefährdet, Erdgas als „Brücken“-Brennstoff für den Übergang von der Kohle zu nutzen.
Wood Mackenzie-Analyst Raghav Mathur erklärte den Engpass mit den Worten: „Niemand hat vorausgesehen, dass die USA bei den Turbinen so weit kommen würden … Selbst wenn asiatische Energieversorger eine Bestellung aufgeben wollen, müssen sie vier oder fünf Jahre warten.“ Eine solche Verzögerung droht, Länder wie Vietnam und die Philippinen zum Stillstand zu bringen, was sie möglicherweise dazu zwingt, sich auf von China unterstützte Kohletechnologie zu verlassen, um ihren Betrieb aufrechtzuerhalten.
Letztendlich besteht das Abkommen zwischen Google und Mombak in dieser komplexen Realität, insbesondere angesichts des bevorstehenden COP30-Klimagipfels, der in Belem, Brasilien, in der Nähe des Projektstandorts stattfinden soll. Obwohl es sich dabei um einen hochintegrierten Ansatz zum CO2-Ausgleich handelt, warnen einige Experten davor, dass solche Schritte ablenken können.
Kompensationskäufe, so glaubwürdig sie auch sein mögen, können direkte Emissionssenkungen nicht ersetzen und bergen das Risiko einer Verzögerung der systemischen Dekarbonisierung, die zur Erreichung globaler Klimaziele erforderlich ist.
Das Umweltbuch der KI-Industrie bleibt somit eine Geschichte zweier widersprüchlicher Narrative: eines von grünen Investitionen und eines von unersättlichem, weltveränderndem Konsum.